
Die Elektrokardiographie ermöglicht das Registrieren, Messen und Analysieren elektrischer Potenziale,
die über genau definierten Ableitungselektroden am Körper gewonnen werden.
Die elektrischen Potenziale entstehen durch die elektrische Aktivität der Zellen des Herzens und werden bis zur
Körperoberfläche weitergeleitet.
Die Aufzeichnung wird auf einem mit genau definierter Geschwindigkeit laufenden Millimeterpapier durchgeführt.
Eine Eichzacke zu Beginn der Aufzeichnung gibt an, welcher Ausschlag einer Spannung von 1mv entspricht.
In der Regel wird hier 1cm Ausschlag = 1 mV verwendet. Die Breite der Eichzacke beträgt 5 kleine Kästchen und damit 0,1 s.
Durch die genau definierte Geschwindigkeit des Registrierpapiers ist es möglich, aus der Breite der einzelnen Zacken
und Abschnitte die Herzfrequenz und die Dauer der Erregung der einzelnen Abschnitte des Herzens zu errechnen .
Die Auswertung der Kurve ermöglicht eine Vielzahl diagnostisch wertvoller Aussagen über Funktion und Zustand
des Reizleitungssystems und des Herzmuskels.
Das EKG hat sich zu einem weit verbreiteten Diagnoseverfahren durchgesetzt und ist heute in der kardiologischen
Diagnostik und bei der Überwachung der Herztätigkeit Schwerkranker unersetzlich.
Und dabei ist es ungefährlich, schnell gemacht und billig.

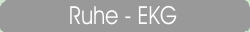
Das Ruhe-EKG ist wohl die am häufigsten eingesetzte EKG-Untersuchung und wird als 12-Kanal-EKG geschrieben. Das 12-Kanal-EKG ist Teil von routinemäßigen
Untersuchungen vor allem bei Patienten über 40 Jahre oder auch bei Jüngeren bei bestehendem Verdacht auf kardiale Erkrankungen.
Das 12-Kanal-EKG ermöglicht die Beurteilung des Zustandes des Herzmuskels und des Reizleitungssystems und gibt Hinweise auf bestehende Erkrankungen,
die dann durch weitere Diagnostik untersucht werden können. Beim Herzinfarkt kann das betroffene Gebiet durch Auswertung der Ableitungen gut eingeschätzt werden.
Interessant sind auch die Verläufe vor und nach einer Erkrankung. Ein Patient mit schwerer Erkrankung einer Herzklappe hat z.B. nach bestimmten Operationen schon bald
wieder einen rückläufigen EKG-Befund.

Beim Belastungs-EKG wird das EKG abgeleitet, während der Patient genau dosiert belastet wird. Dabei kann es bei Koronarinsuffizinenz zu
EKG-Veränderungen kommen, die z.T im Ruhe-EKG nicht nachweisbar sind. Das Auftreten von Herzrhythmusstörungen kann ebenfalls eine Folge der Belastung sein.

Bei Patienten mit Verdacht auf Herzrhythmusstörungen wird das Langzeit-EKG eingesetzt. Damit kann man den Herzrhythmus über
mindestens 24 Stunden oder auch länger beobachten. Die Geräte sind in Folge der Miniaturisierung kaum größer als eine AA-Batterie. Die heutigen Geräte
ermöglichen eine elektronische Auswertung.